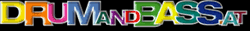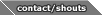mat
sound.selectah

Reg.: May 2001
Location: planet.funk!
Posts: 1767 |

google - auslandsschlachthof st marx eingeben...
Arena
Während die Besetzung des Amerlinghauses nur lokale Bedeutung hatte, konzentrierten sich im Sommer 1976 die Bewegungen in der Besetzung der Arena im Auslandsschlachthof St. Marx, an der Grenze zwischen Erdberg und Simmering.
Die Veranstaltungsreihe „Arena“ war als junge Alternative zu den Wiener Festwochen gedacht, die 1970 und 1972 im Museum des 20. Jahrhunderts stattgefand, 1974 im Theater im Künstlerhaus. Es hat auch autonome Gegenveranstaltungen linker KünstlerInnen gegeben wie 1970 die Arena 70/II im adaptierten Striplokal Casanova (Keller 1983, S. 101). 1975 war die Festwochenarena das erstemal im Schlachthof. Nach der Festwochenarena 1976 sollten die Gebäude abgerissen und statt dessen ein mehrstöckiges Textilzentrum errichtet werden. Am 20. Juni verteilte eine Gruppe ArchitekturstudentInnen ein Flugblatt mit der Parole „Der Schlachthof darf nicht sterben.“ In einer Absprache mit den Musikgruppen „Schmetterlinge“ und „Keif“ wurde ausgemacht, daß sie am Ende der Festwochen möglichst viele Menschen über den Abbruch informieren wollten (Langer 1983, S. 16ff).
Am 27. Juni 1976 fand am Wiener Naschmarkt das „Anti-Schleiferfest“ gegen Schikanen beim Bundesheer statt. Im Anschluß daran riefen die „Schmetterlinge“ und „Keif“ dazu auf, ein Abschlußfest im Schlachthof St. Marx zu feiern. Um 21 Uhr waren schon viele Menschen auf der Wiese vor der Arena anwesend, die Polizei hatte das Gelände abgeriegelt, es wurden Unterschriften gesammelt. Etwa 700 Menschen diskutierten, was zu unternehmen sei. Als jemand mitteilte, daß eine Tür offen sei, verlagerte sich das Geschehen nach innen, die Forderungen der ArchitektInnen wurden um die Forderung nach Selbstverwaltung erweitert (Steiner 1998, S. 140ff): 1. Der Schlachthof St. Marx darf nicht abgerissen werden, 2. das gesamte Gelände muß als Kultur- und Kommunikationszentrum das ganze Jahr offen sein, 3. Selbstverwaltung: alle, die mittun, bestimmen gemeinsam, was in der Arena geschieht, 4. die Gemeinde Wien soll zur Unterstützung der Aktivitäten die Betriebskosten zahlen (Langer 1983, S. 23). Die Polizei versuchte einen der ArchitektInnen verantwortlich zu machen, worauf die Versammlung mit „Verantwortlich sind wir alle“ antwortete. In der Nacht bröckelten die BesucherInnen ab, für den nächsten Tag, den 28. Juni wurde eine Pressekonferenz einberufen und die BesetzerInnen wurden wieder mehr. Ein Konzert wurde für den Dienstag, den 29. Juni angekündigt, zuerst wurde es von der Polizei untersagt, aber nach langen Verhandlungen durfte die Veranstaltung mit 2000 BesucherInnen durchgeführt werden. Bis zum ersten Wochenende fanden zahlreiche Veranstaltungen statt, von Dichterlesungen bis zu Musik und Theater. Obwohl (oder gerade weil?) es keine Verhandlungen gab, wurde zugesagt, Strom und Wasser vorerst nicht abzudrehen. Die Veranstaltungen am 3. Juli und 4. Juli waren ein voller Erfolg, es waren einige Tausend BesucherInnen anwesend (die Angaben schwanken zwischen 8000 und 12000), um Mitternacht kam Leonhard Cohen nach seinem Auftritt im Konzerthaus in die Arena. Auch der Psychologe Peter Brückner, der gerade auf Einladung der FÖJ zu Besuch war, sprach an diesem Wochenende zu den Versammelten (Langer 1983, S. 24ff).
Das Besondere an der Arena war, daß es sich nicht ein Gebäude handelte, sondern eine Reihe unterschiedlicher Bauten auf einer Gesamtfläche von 70.000m2, von einer Mauer umgeben. Trotz der Räumungsangst in den ersten Tagen konnte sich ein riesiges Potential an Kreativität und Einfallsreichtum austoben, eine Reihe von Räumlichkeiten wurden für verschiedene Funktionen adaptiert (Langer 1983, S. 29). So entstanden mit der Zeit neben den Veranstaltungssälen (Theaterhalle, Video und Dia, Diskothek, große Halle, die Rote Halle der KPÖ) das Haus Simmering für die Jugendlichen aus der Umgebung, mehrere Cafés (Café „Schweinestall“, Teehaus, Literatencafé), eine Galerie, ein Soldatenhaus, wo es Rechtsberatung für die Soldatenkomitees gab, ein Frauen- und ein Kinderhaus. Die Organisation lief über ein gewähltes Komitee (lauter Männer mit einer Alibifrau – AUF Nr. 8, S. 24), durch das sich aber – wie denn auch anders – soziale und intellektuelle Trennungen (Kopf und Handarbeit) ausdrückten, es wurden die gewählt, die das Maul am weitesten aufrissen. Es gab die Macher, aber sie wurden auch kritisiert, nicht umsonst dauerten Organisationsdebatten stundenlang. Ansatzweise wurde auch versucht, die Trennung zwischen künstlerischer Produktion und den KonsumentInnen aufzuheben. Aber es blieben eine bestimmte Anzahl von BesetzerInnen im Gegensatz zu sehr vielen BesucherInnen.
Frauen versuchten sich zu organisieren und stießen auf große Probleme (vgl. AUF Nr 8, S. 20ff): Da war der unverhohlene Sexismus, der u.a. aus dem Frauenhaus ein „Freudenhaus“ machen wollte und von der Mehrheit der BesetzerInnen nicht oder nur widerwillig kritisiert und bekämpft wurde. Als einzig positives Erlebnis wird in den AUF-Artikeln erwähnt, daß sich doch einige Männer für die Betreuung der Kinder zu interessieren begannen. Sonst war wie immer alles an den Frauen hängengeblieben. Die wenigen aktiven Feministinnen fühlten sich isoliert und suchten Unterstützung. Hinzuzufügen ist noch, daß die negativen Berichte über ihre Situation als Frauen und Feministinnen aus den ersten Wochen stammten, wo noch nicht soviel Resignation und Probleme aufgetaucht waren. So ist es nicht verwunderlich, daß diese Arena-Erfahrungen mit ein Grund waren, den Feminismus zu radikalisieren. Im Herbst gründeten die Arena-Frauen eine Radikalengruppe, die eine radikal-feministische Alltagspraxis umsetzen wollte (Geiger/ Hacker 1989, S. 59).
Anfangs konnten durch die Spenden bei den Veranstaltungen am Wochenende[15] ein großer Teil der Besetzungskosten gedeckt werden. Mit der Dauer der Besetzung nahmen die Probleme zu, Anfang August kam es zum Zusammenbruch der Küche, Geld fehlte, Gratisessen gab es ab da nur noch für Personen, die auf dem Gelände auch arbeiteten. Immer mehr der kreativen BesetzerInnen blieben weg, die Problemfälle, deren Existenz an der Arena hing, blieben. Interne Konflikte nahmen zu. Schon von Beginn an wurden von den Medien teilweise die hygienischen Bedingungen kritisiert, ein (angeblicher) Fall von Krätze wurde ausgeschlachtet. Es gab immer wieder Diskussionen über die Kompetenzverteilung zwischen Plenas und dem Komitee. Als Ergänzung wurde ein Arbeitsgruppenrat mit Delegierten aus den Arbeitsgruppen gewählt[16]. Die Gemeinde Wien verstärkte Mitte August den Druck, so verlangte sie jetzt von den auftretenden MusikerInnen die Bezahlung von Getränke- und Vergnügungssteuer. Die Gemeinde verlangte eine verbindliche Rechtsform (einen Verein) für die Arena, die Opponenten beharrten aber auf dem Komitee als verhandlungsbevollmächtigten Gremium. Am 9. und am 10. September kam es zu Naziüberfällen. Mit dem ebenfalls Anfang September erfolgtem Angebot eines Ersatzgebäudes, des Inlandschlachthofes, verstärkte sich auch der Druck durch die Polizei, immer wieder gab es Razzien. Die aktive Solidarität der zehntausenden UnterschreiberInnen und BesucherInnen hielt sich in Grenzen, für die meisten bedeutete die Arena doch nicht mehr als eine kreative Konsummöglichkeit. Am 19. September wurde Strom und Wasser abgedreht, am 27. September beschloß der Gemeinderat den Verkauf des Auslandschlachthofes,. Die Diskussionen bei den Plenas kamen zu widersprüchlichen Entscheidungen, je nachdem, wer gerade mehr Leute mobilisieren konnte – Übersiedlung in den Inlandsschlachthof oder Verteidigung. Am 6. Oktober gab es noch eine lange Demonstration durch die Stadt[17]. Am selben Abend beschloß das Plenum die freiwillige Räumung, der Inlandsschlachthof sollte aber nicht angenommen werden, weil die Gruppe zu zerrüttet war. Am 9. Oktober gab es noch ein Fest und am 12. Oktober begann der Abriß, Arena-Vollversammlungen wurden ab jetzt im Porrhaus abgehalten. In einer letzten theatralischen Demonstration wurde am 22. Oktober mit schwarzdrapierten Fiakern, Blasmusik und Klageweibern die Wiener Kulturpolitik zu Grabe getragen (Langer 1983).
Während die BesetzerInnenbewegung darniederlag – die PolitaktivistInnen fanden andere Aktivitäten, besonders in der aufkommenden Anti-AKW-Bewegung, andere zogen sich in WGs zurück - bemühte sich ab 1977 eine kleine Gruppe von InteressentInnen um die Nutzung des Inlandschlachthofes und gründete den Verein „Forum Wien Arena“. Am 23. März kam es nach einer Begehung des Geländes zu einer, allerdings schnell wieder geräumten Besetzung (ZB Nr. 5). Zum Fackelzug der JungsozialistInnen am 30. April 1977 wurde unter Applaus ein Arena-Transparent entfaltet, im Juli 1977 traten einige AktivistInnen in einen Hungerstreik und ab 29.Juli 1977 blieben sie in einem halblegalem Zustand in den Räumlichkeiten (Arenazeitung Nr. 15, April 1978). Anfangs zeichnete sich die Situation durch Unsicherheit, interne Streitereien und soziale Probleme aus, trotz der prekären Situation konsolidierte sich die Situation und wurde ab 1980 unter Druck einer „neuen“ Jugendbewegung legalisiert (Wien wirklich 1983, S. 145).
Trotz des tristen Endes hatte die Arena eine gewaltige Ausstrahlung, zehntausende hatten sie besucht, besonders an den Wochenenden kamen auch viele BesucherInnen aus den Bundesländern und konnten in eine relativ befreite Atmosphäre hineinschnuppern – für Außenstehende erschienen die Probleme untergeordnet. Hunderttausende hatten die Auseinandersetzungen über die Medien mit Sympathie beobachtet und praktisch die gesamte Öffentlichkeit in Österreich hat mitgekriegt, daß etwas abgeht
__________________
There will come a time in your life when you will ask yourself a series of questions. Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with the way my life is going? Do I have a life or am I just living? Do not let these questions strain or trouble you just point yourself in the direction of your dreams find your strengh in the sound and make your transition.
Report this post to a moderator | IP: Logged
|